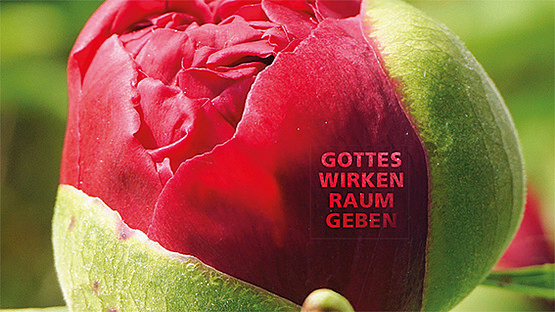Vereint in Unterschieden


Das echte Leben ist bunt. Es gibt viele schillernde Farben zwischen Schwarz und Weiß, unzählige unterschiedliche Denkweisen und Blickwinkel, aus denen wir Menschen unser Dasein und die Welt um uns betrachten. Wie erfrischend und belebend das ist, konnten zahlreiche Interessierte in Oberursel erleben. Das „Muslimisch-Jüdische Abendbrot“ mit Saba-Nur Cheema und Meron Mendel lockte ins Kulturcafé Windrose, das bis auf den letzten Platz gefüllt war.
Saba-Nur Cheema ist eine deutsche Politologin und Publizistin, geboren 1987 in Frankfurt am Main als Tochter muslimisch-pakistanischer Eltern, die als Geflüchtete nach Deutschland kamen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem israelisch-deutschen Pädagogen und Autor Meron Mendel, der im Kibbuz aufwuchs, schreibt sie seit 2021 die Kolumne „Muslimisch-jüdisches Abendbrot“ im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nun ist daraus ein Buch entstanden, das Anlass für ein ebenso amüsantes wie facettenreiches Gespräch mit dem Moderator Meinhard Schmidt-Degenhard war. Als Paar mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln erzählten sie von den Herausforderungen und Chancen eines Dialogs über kulturelle, religiöse und politische Grenzen hinweg.
IDENTITÄTEN
„Unseren Kindern ist die muslimisch-jüdisch-pakistanisch-hessische Identität in die Wiege gelegt!“, schmunzelte die Publizistin eingangs. Mit Erstaunen hätten sie und ihr Mann mit der Geburt des ersten gemeinsamen Sohnes gelernt, dass in Deutschland zwar eine doppelte Staatsangehörigkeit möglich sei, jedoch nicht eine doppelte Religionszugehörigkeit. Hinzu komme, dass nach muslimischer Tradition die Religion über den Vater weitergegeben werde, im jüdischen Glauben aber über die Mutter „vererbt“ werde. Grundsätzlich verstehe sie den Wunsch nach Eindeutigkeit, sagte Cheema. „Aber warum kann religiöse Identität nicht und bedeuten, statt oder?“ Sie und ihr Mann redeten oft darüber, wie unterschiedlich sie in Sachen Religion aufgewachsen seien.
Er in Israel, wo das Judentum die Mehrheitsreligion sei – sie in Deutschland, wo der Islam eine Minderheitsreligion sei, auch wenn knapp sechs Millionen Menschen hierzulande Muslime seien. Das Paar sei sich einig, dass die Realität der Gesellschaft mit dem Begriff der „hybriden Identität“ richtig abgebildet werde. Dieser beschreibe die gleichzeitige Zugehörigkeit zu mehreren kulturellen, religiösen oder sozialen Identitäten, die sich in einer Person überlagerten und miteinander verschmelzen könnten. Sie entstehe oft durch Migration oder interkulturellen Austausch und ermögliche es Individuen, flexibel zwischen verschiedenen kulturellen Kontexten zu navigieren.

DANKBARKEIT UND DISKRIMINIERUNG
Am meisten „krachte“ es in der Beziehung wegen der unterschiedlichen Migrationserfahrungen des Paares. Mendel ist vor rund 25 Jahren für ein Studium nach Deutschland gekommen. Mittlerweile ist er promoviert, leitet die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Er empfinde immer eine gewisse „Dankbarkeit“ für Deutschland, berichtete er. Gleichzeitig wisse er aber auch, dass er als weißer Akademiker eine privilegierte Rolle in der Gesellschaft habe. Seine Frau hingegen habe insbesondere in der Zeit des Heranwachsens immer wieder erlebt, dass sie sich beweisen müsse – wegen ihres Geschlechts, ihrer Erscheinung, ihrer Religionszugehörigkeit. Der Satz „Du sprichst aber gut Deutsch!“ werde von beiden komplett unterschiedlich wahrgenommen.
POLARISIERUNG UND DIALOG
Nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hätten Cheema und Mendel eine extreme Stärkung der gesellschaftlichen Ränder beobachtet. Das Paar fordere daher eine sachliche Diskussion, ohne platte Schuldzuweisungen oder einseitige Narrative. Eine Zwei-Lager-Logik fördere eine Radikalisierung hin zum Anspruch: „Jetzt musst du aber zu deiner Community stehen!“ Auch durch soziale Medien werde der Blick immer enger, weil sich Nutzerinnen und Nutzer zunehmend in bestimmte Themen oder Überzeugungen vertieften und dabei den Bezug zur breiteren Perspektive verlören. „Ich erlebe stark, dass die Debatten von Menschen sehr vehement geführt werden, die sich als ‚Sprecher‘ ihrer Gruppe fühlen. Aber die anderen der Gruppe sehen das nicht so, sie haben differenziertere Ansichten“, so Mendel. Wichtig sei, weiterhin im Dialog zu bleiben. Dies gelte auch in der politischen Debatte um die Wählerschaft der in Teilen rechtsradikalen AfD. „Diese Wähler zu verurteilen, ist ein grober Fehler. Die Frage ist: Warum haben wir sie verloren?“ Das Problem, dass sich Wählerinnen und Wähler nicht mehr durch traditionelle Politik angesprochen fühlten, führe über die Grenzen Deutschlands hinaus. Es sei international zu beobachten, dass bei Teilen der Bevölkerung der Eindruck zunehme, zentrale Themen würden über ihre Köpfe hinweg verhandelt. Cheema plädierte: „Wir wünschen uns, dass man in den Dialog geht. Es ist ein fatales Signal zu sagen: Wir sprechen mit einem Fünftel der Wählenden nicht mehr.“ Der stete Austausch sei wichtig, auch wenn es verbal äußerst ungemütlich werde. Man müsse aushalten, dass es auch mal hitzig werde. „Da muss es auch mal knallen, wenn man es sich vorher zu gemütlich gemacht hat“, forderte die Publizistin unter dem Beifall des Publikums.
Wichtig sei es den beiden Podiumsgästen gewesen zu betonen, dass sie sich nicht als Vorzeigepaar sähen. Ihre Ehe sei kein interreligiöses Projekt, und sie wollten und würden nicht der Projektion anderer entsprechen. Ihr Ziel sei ein offener, aber fundierter gesellschaftlicher Diskurs, der sich nicht von Extrempositionen treiben lasse. Cheema fasste abschließend treffend zusammen: „Für uns ist der Dialog der Weg – und das Scheitern gehört dazu.“
Hintergrund
Meron Mendel und Saba-Nur Cheema wurden für ihr herausragendes Engagement in der politischen Bildung und ihren Einsatz gegen Antisemitismus und Rassismus mehrfach ausgezeichnet. Im Jahr 2023 erhielten beide das Bundesverdienstkreuz zum Tag der Deutschen Einheit. Mit dieser Ehrung würdigte die Bundesrepublik Deutschland ihre bedeutenden Beiträge zur gesellschaftlichen Aufklärung und interreligiösen Verständigung.
Ein Jahr später, 2024, wurden sie mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet, die vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit verliehen wird. Diese Auszeichnung ehrt Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise für den Dialog zwischen Religionen und Kulturen einsetzen. Beide Ehrungen unterstreichen die nachhaltige Wirkung ihrer Bildungsarbeit und ihren unermüdlichen Einsatz für eine demokratische, pluralistische Gesellschaft.